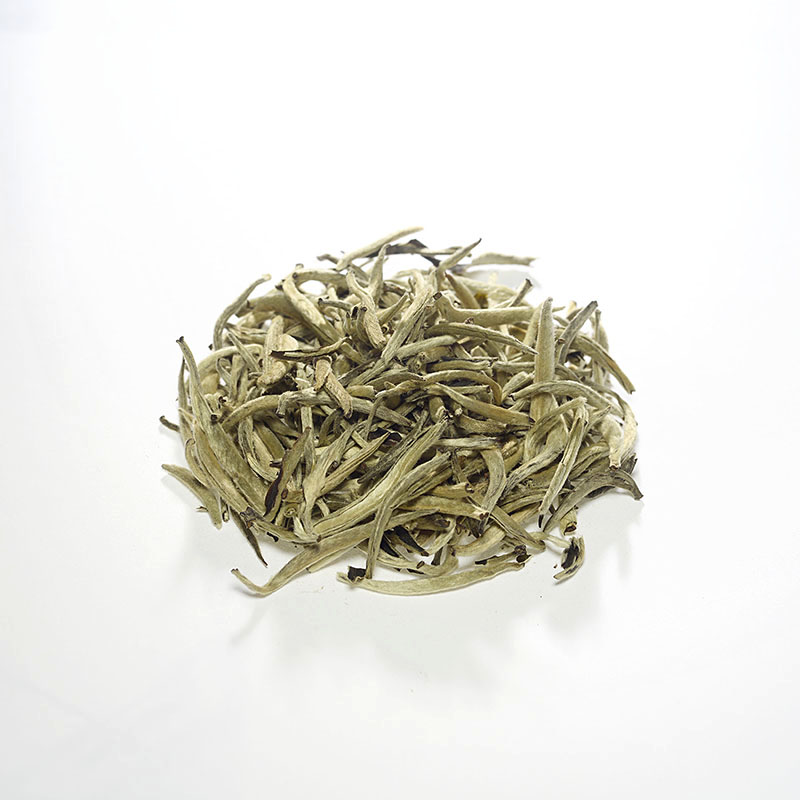KAFFEE LEXIKON
mehr als nur Bohnen
Unser kleines Kaffeelexikon
Tomoni, gemeinsam mehr erfahren
Kaffee ist Magie in der Tasse – mal stark, mal sanft, mal schokoladig, mal zitronig, mal fruchtig süß. In diesem Lexikon tummeln sich kleine und große Begriffe rund ums Lieblingsgetränk der Welt.
Kaffee beginnt als kleine, rote Frucht – und wird erst durch viel Handarbeit, Wissen und Leidenschaft zur aromatischen Bohne, die wir lieben.
Je nach Anbaugebiet, Klima und Verarbeitung entstehen völlig unterschiedliche Geschmacksprofile. Dieses Lexikon nimmt dich mit auf eine Reise durch die bunte Welt des Kaffees – von der Kirsche bis in die Tasse.
Kaffee beginnt als kleine, rote Frucht – und wird erst durch viel Handarbeit, Wissen und Leidenschaft zur aromatischen Bohne, die wir lieben.
Je nach Anbaugebiet, Klima und Verarbeitung entstehen völlig unterschiedliche Geschmacksprofile. Dieses Lexikon nimmt dich mit auf eine Reise durch die bunte Welt des Kaffees – von der Kirsche bis in die Tasse.
Kaffeearten
Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Hinter dem beliebten Getränk stecken vier Hauptarten, jede mit eigener Herkunft, Persönlichkeit und Geschmack.
Arabica, die beliebteste und aromatischste Art. Sie wächst in höheren Lagen, ist anfällig für Krankheiten, aber geschmacklich sehr komplex – mit Noten von Früchten, Blumen, Schokolade oder Karamell.
Robusta ist robuster – der Name ist Programm. Sie wächst in niedrigeren Lagen, ist widerstandsfähiger und koffeinreicher. Der Geschmack ist kräftiger, erdiger, oft nussig oder leicht bitter. Robusta liefert viel Crema im Espresso und wird oft in Mischungen verwendet.
Liberica, eine seltene, großwüchsige Pflanze mit großen, unregelmäßigen Bohnen. Liberica ist hitze- und krankheitsresistent, bringt aber einen sehr eigenwilligen Geschmack hervor – rauchig, holzig, mit tropischer Fruchtnote.
Excelsa, lange als eigene Art geführt, heute meist als Unterart der Liberica klassifiziert. Excelsa bringt leichte, fruchtige, säurebetonte Tassen mit komplexem Charakter hervor. Sie wird selten sortenrein angeboten, sondern meist zur Abrundung von Mischungen verwendet.

Arabica (Coffea arabica) – Die Königin der Kaffees
1) Herkunft & Geschichte
Arabica stammt ursprünglich aus den äthiopischen Hochländern. Der Legende nach entdeckte der Ziegenhirte Kaldi die belebende Wirkung der Kaffeekirschen. Über den Jemen und den Hafen von Mokha verbreitete sich Arabica weltweit.
2) Pflanzeneigenschaften
-Selbstbestäubend, genetisch komplex (44 Chromosomen)
-Wächst in Höhenlagen von 800–2200 m
-Liebt kühles Klima und große Temperaturschwankungen
3) Geschmack
Fruchtig, blumig, süßlich, schokoladig – abhängig von Herkunft und Verarbeitung
4) Besonderheiten
– Empfindlich gegenüber Schädlingen (z. B. Kaffeerost, Kaffeekirschenbohrer)
– Geringere Erträge als Robusta
– Besonders anfällig für Klimawandel
5) Bekannte Varietäten
– Geisha (Gesha): Floral, tropisch, ursprünglich aus Äthiopien
– SL28/SL34: Fruchtig, lebendige Säure, aus Kenia
– Pacamara: Groß, süß, komplex
– Typica: Klassisch, klar, ausgewogen
-Bourbon: Süß, rund, aromatisch
Robusta (Coffea canephora) – Der Kräftige
1) Herkunft & Geschichte
Später entdeckt als Arabica, stammt Robusta aus Westafrika. Ab dem 19. Jahrhundert wurde er wegen seiner Widerstandsfähigkeit wirtschaftlich bedeutend – besonders für Instantkaffee und Espressomischungen.
2) Pflanzeneigenschaften
• Wächst in tieferen Lagen (0–800 m)
• Robust gegenüber Krankheiten und Hitze
• Schnell wachsend, ertragreich
3) Geschmack
Kräftig, bitter, erdig, torfig, malzig, crémig – bei guter Verarbeitung auch schokoladig und nussig. Ideal für eine dichte Crema im Espresso.
Liberica (Coffea liberica) – Die Seltene
1) Herkunft & Geschichte
Ursprünglich aus Liberia. Wurde im 19. Jahrhundert populär, als Arabica-Pflanzen großflächig vom Kaffeerost befallen wurden. Heute nur noch in wenigen Regionen angebaut.
2) Pflanzeneigenschaften
• Sehr große, oft asymmetrische Bohnen
• Dicke Schale, aufwendige Verarbeitung
3) Geschmack
Wuchtig, rauchig, teils holzig. Polarisierend, aber charakterstark – mit fruchtigen, exotischen Noten.
Excelsa (Coffea excelsa) – Der Exotische
1) Herkunft & Bedeutung
Eine Unterart der Liberica, angebaut vor allem in Südostasien. Macht unter 1 % der weltweiten Produktion aus.
2) Geschmack
Komplex, fruchtig, säuerlich-herb – mit einem Hauch Exotik. Wird oft zum Veredeln von Mischungen genutzt.
fun fact
Im 18. Jahrhundert glaubten manche Europäer, dass Kaffee Männer unfruchtbar machen könnte – also haben sie stattdessen lieber Bier zum Frühstück getrunken.
Kaffee = gefährlich, Bier = gesund. Medizinische Logik auf höchstem Niveau!
schliessen
Aufbereitungsarten- von der Kirsche bis zur Bohne
Jede Aufbereitungsmethode beeinflusst das Aroma, die Säure, die Süße und den Körper des Kaffees auf einzigartige Weise.
Hier sind die wichtigsten Methoden – einfach erklärt, mit Details zu den chemischen Prozessen, regionalen Unterschieden und modernen Entwicklungen.

Trockene Aufbereitung (Natural Process)
1) Hintergrund:
Die älteste Form der Aufbereitung, typisch für trockene Regionen wie Äthiopien und Jemen. Die gesamte Kirsche wird in der Sonne getrocknet – ohne vorherige Entfernung des Fruchtfleischs.
2) Ablauf im Detail:
Ernte: Nur reife, rote Kirschen werden idealerweise per Hand gepflückt.
Sortierung: In Wasserbädern trennt man reife Kirschen (sinken) von unreifen oder beschädigten (schwimmen).
Trocknung: Auf Hochbetten („African Beds“) oder Betonböden ausgebreitetTrocknung dauert 2–4 Wochen, tägliches Wenden verhindert Schimmel, Gärung oder ungleichmäßige Trocknung
Entfernung des Fruchtfleischs: Nach vollständiger Trocknung (Feuchtegehalt <12 %) wird die Bohne mechanisch von der vertrockneten Fruchthülle befreit.
3) Chemische Prozesse:
Zucker, Pektine und Enzyme aus dem Fruchtfleisch fermentieren langsam mit der Bohne. Dadurch entstehen fruchtige, süße Aromen und ein voller Körper.
4) Typische Geschmacksmerkmale:
-Beeren, Trockenfrüchte, manchmal fermentierte oder „weinige“ Noten
-Voller Körper, geringe Säure
5) Herausforderungen:
-Hoher Aufwand bei der Trocknung
– Risiko von Schimmel oder fauligen („overfermented“) Bohnen bei schlechter Kontrolle
Nasse Aufbereitung (Washed Process)
1) Hintergrund:
Entwickelt zur Betonung von Säure und Klarheit. Typisch für Regionen mit reichlich Wasser (z. B. Zentralamerika, Ostafrika).
2) Ablauf im Detail:
Entpulpung: Die Fruchthaut wird mechanisch entfernt. Zurück bleibt die Bohne mit Mucilage (Schleimschicht).
Fermentation: In Wasserbädern für 12–72 Stunden
-Hefen & Bakterien bauen die Mucilage ab
-Temperatur und Zeit beeinflussen Aromen stark
Waschen: Nach Abschluss der Fermentation wird die Mucilage durch Reibung entfernt.
Trocknung:
-Auf Trockenbetten oder Böden
-Gleichmäßige Trocknung über 1–2 Wochen
-Endfeuchte: 10–12 %
3) Chemische Prozesse:
Die Fermentation ohne Fruchtfleisch ergibt besonders saubere Aromen. Die mikrobielle Aktivität beeinflusst Säurestruktur und Klarheit.
4) Typische Geschmacksmerkmale:
-Zitrus, florale Noten, saubere Tassen
-Leichter bis mittlerer Körper, ausgeprägte Säure
5) Herausforderungen:
-Sehr wasserintensiv
-Risiko einer „überfermentierten“ Tasse bei falscher Zeitführung
Honey Process (Pulped Natural / Semi-Washed)
1) Hintergrund:
Zwischenform aus trockener und nasser Methode, ursprünglich aus Costa Rica. „Honey“ bezieht sich auf die klebrige Mucilage, nicht auf Geschmack oder Zusatzstoffe.
2) Ablauf im Detail:
Teilweise Entpulpung: Fruchthaut wird entfernt, Mucilage bleibt in variabler Menge an der Bohne.
Trocknung: Bohnen mit Schleimschicht werden auf Trockenbetten ausgelegt
-Sehr empfindlich: gleichmäßige, langsame Trocknung nötig
Kategorisierung:
-Yellow Honey: wenig Mucilage – klarer Geschmack
-Red Honey: mittlere Menge – mehr Süße & Körper
-Black Honey: viel Mucilage – intensives, dunkles Profil
3) Chemische Prozesse:
Zucker & Pektine im Schleim fermentieren während des Trocknens. Je mehr Mucilage, desto süßer und körperreicher das Ergebnis.
Typische Geschmacksmerkmale:
-Honig, Karamell, rote Früchte
-Mittlerer bis voller Körper, mildere Säure
4) Herausforderungen:
-Hoher Pflegeaufwand (z. B. Wenden, Belüftung)
-Anfällig für Schimmel bei feuchtem Klima
Fermentationsmethoden
Moderne Kaffeeproduzenten nutzen kontrollierte Fermentation gezielt zur Aromensteuerung.
1) Anaerobe Fermentation
• Luftdichte Tanks → kontrollierte Umgebung
• Milchsäurebakterien dominieren, weniger Sauerstoff
Geschmack: Komplex, würzig, intensiv (z. B. Zimt, Pflaume, Tropenfrüchte)
2) Carbonic Maceration
• Ganze Kirschen fermentieren unter CO₂-Druck (angelehnt an Weinbereitung)
• Zelltod in der Kirsche setzt Enzyme & Aromen frei
Geschmack: Saftig, tropisch, ungewöhnlich klar (z. B. Ananas, Erdbeere)
3) Experimentelle Fermentation
• Zusatz von Hefekulturen oder Fruchtpürees
• Zielt auf kreative, seltene Aromen
Beispiel:
• Saccharomyces cerevisiae → süße, klare Fruchtaromen
• Kakao- oder Beerenfermentation → exotische Cups
fun fact
Bei der trockenen Aufbereitung kann es passieren, dass sich beim Wenden der Kaffeekirschen auf großen Trockenbetten ein ganzer Haufen “Tanzender Bohnen” bildet – denn bei starkem Wind hüpfen die getrockneten Kirschen manchmal wie verrückt über das Bett.
In manchen Anbauregionen nennt man das scherzhaft den “Kaffeetanz” – ganz ohne Musik, nur mit Wind und guter Laune.
schliessen
Entkoffeinierungs Methoden – Koffein raus, Genuss bleibt
Entscheidend ist die Methode der Entkoffeinierung, denn sie beeinflusst das Aroma, die Qualität und Nachhaltigkeit des Endprodukts.
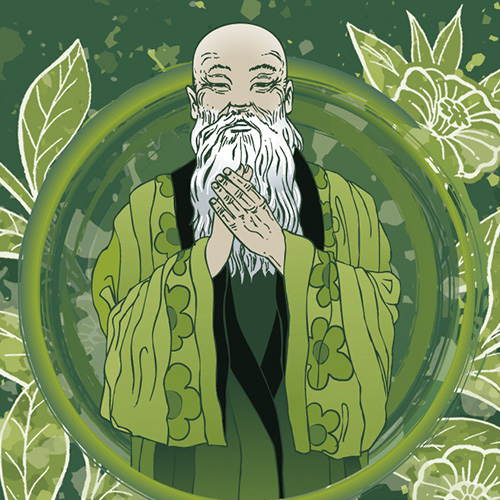
Lösungsmittelbasierte Verfahren
Diese Methoden nutzen organische Lösungsmittel, um Koffein selektiv zu extrahieren. Es handelt sich um die weltweit am häufigsten verwendeten Prozesse – vor allem für industriellen Decaf-Kaffee.
Ethylacetat-Verfahren („Natürliches Lösungsmittelverfahren“)
1) Grundprinzip:
-Die grünen Kaffeebohnen werden gedämpft oder in Wasser eingeweicht, um Zellstrukturen zu öffnen.
-Anschließend werden sie mit Ethylacetat behandelt, einem natürlichen Lösungsmittel, das selektiv Koffein bindet.
– Nach mehreren Zyklen wird der Rest des Lösungsmittels durch Dampf entfernt.
Herkunft des Lösungsmittels:
-Kann chemisch hergestellt oder aus Zuckerrohr fermentiert werden → „natürliches Decaf“.
2) Vorteile:
-Preiswert, effizient.
-Gilt als unbedenklich bei korrekter Anwendung.
3) Nachteile:
-Kann bei schlechtem Handling Aromen verfälschen
-„Natürlich“ bezieht sich auf das Lösungsmittel, nicht auf den Kaffee.
Dichlormethan-Verfahren (DCM-Verfahren)
1) Grundprinzip:
-Ähnlich wie beim Ethylacetat-Verfahren, aber mit Dichlormethan (DCM) als Lösungsmittel.
-Das Koffein wird extrahiert, DCM verdampft beim Erhitzen.
2) Anwendung:
-In der EU und USA zugelassen, unterliegt strengen Rückstandsgrenzen.
3) Vorteile:
-Sehr effektiv, bewahrt viele Aromastoffe
-Lange erprobt und gut kontrollierbar
4) Nachteile:
-DCM ist ein industrielles Lösungsmittel mit toxischem Potenzial bei Missbrauch
-Für einige Konsumenten aus ethischer Sicht problematisch
Wasserbasierte Verfahren
Hier wird das Koffein durch Wasser ausgelöst, oft in Kombination mit Aktivkohle- oder Osmosefiltern. Diese Methoden sind lösungsmittelfrei und gelten als besonders schonend.
Swiss Water Process
1) Herkunft:
Schweiz, heute vor allem in Kanada angewendet
2) Grundprinzip:
-Die grünen Bohnen werden in warmes Wasser eingeweicht → Koffein und Aromastoffe lösen sich.
-Dieses Wasser wird durch einen Aktivkohlefilter geleitet, der nur das Koffein entfernt.
-Die Bohnen werden anschließend in dieses „aromatische, aber koffeinfreie Wasser“ zurückgegeben, um Geschmack wieder aufzunehmen.
3) Vorteile:
-100 % frei von Lösungsmitteln
-Sehr schonend, bewahrt Aroma
-Bio- und Fairtrade-zertifiziert möglich
4) Nachteile:
-Aufwändig, teuer
-Nicht alle Aromen lassen sich vollständig bewahren
Mountain Water Process
1) Herkunft:
Mexiko (Descamex)
Ähnlich wie Swiss Water, jedoch mit Quellwasser aus dem Orizaba-Gebirge.
Ziel: Gleiches Prinzip wie “Swiss Water Methode” , regionale Anwendung.
2) Vorteil:
• Nachhaltig, lokal, lösungsmittelfrei
Wird verwendet für:
Wird oft für Bio-zertifizierte Kaffees aus Mittelamerika angewendet.
CO2-Verfahren (überkritisches Kohlendioxid)
1) Grundprinzip:
• Die Bohnen werden in einem Druckbehälter mit überkritischem CO₂ behandelt (zwischen gasförmig und flüssig).
• CO₂ dringt in die Bohne ein und bindet gezielt das Koffein, ohne Aromakomponenten zu stark zu lösen.
• Das koffeinhaltige CO₂ wird in einem weiteren Behälter gesammelt und getrennt.
2) Vorteile:
• Sehr aromaschonend
• Keine chemischen Lösungsmittel
• Wiederverwendbarer CO₂-Kreislauf → umweltfreundlich
3) Nachteile:
• Teuer, hohe technische Anforderungen
• Meist nur bei Großröstern eingesetzt
Wird verwendet für:
• Hochwertigen Espresso-Decaf und Spezialitätenkaffee
Indirekte Methode mit Wasserlösung „Indirect Solvent Process“
1) Besonderheit:
• Kaffee wird in Wasser eingeweicht, das Koffein und Aromen extrahiert.
• Lösungsmittel (z. B. Ethylacetat) wird dann nur auf die Flüssigkeit, nicht auf die Bohne selbst, angewendet.
• Danach wird das Aroma-Wasser wieder mit den Bohnen zusammengeführt.
2) Vorteil:
• Weniger direkter Lösungsmittelkontakt
• Zwischenlösung bei größeren Produktionen
Sugar Cane Decaf (EA aus Zuckerrohr)
Andere Bezeichnungen: Natural EA Process, EA Sugarcane Process, Kolumbianisches Verfahren
3) Herkunft:
Ursprünglich in Kolumbien entwickelt, wo Zuckerrohr reichlich verfügbar ist. Dabei wird Ethylacetat (EA) aus fermentiertem Zuckerrohr gewonnen – also ein natürliches Lösungsmittel.
4) Grundprinzip:
• Die grünen Bohnen werden mit Dampf befeuchtet, um sie aufnahmefähig zu machen.
• Anschließend werden sie in EA aus Zuckerrohr gebadet, das selektiv Koffein bindet.
• Danach werden die Bohnen erneut gedämpft, um Rückstände vollständig zu entfernen.
5) Wichtig:
Anders als bei synthetischem EA (industriell erzeugt) handelt es sich hier um biologisch gewonnene Substanzen – daher auch bei vielen Spezialitätenröstern akzeptiert.
6) Vorteile:
• Natürliches Lösungsmittel → clean label
• Weniger chemiebelastet als klassisches Lösungsmittelverfahren
• Bewahrt viele sortentypische Aromen
• Nachhaltig, da lokale Ressourcen (Zuckerrohr) genutzt werden
7) Nachteile:
• Aromaverlust möglich, wenn minderwertig durchgeführt
• Bisher vor allem auf kolumbianische Kaffees begrenzt
Typische Aromen:
• Sanft, karamellig, mit milder Säure
• Weniger intensiv als bei CO₂- oder Wasserverfahren, aber rund und angenehm
8) Einsatzgebiet:
• Specialty Coffee aus Kolumbien
• Immer häufiger auch in Direct-Trade-Röstereien weltweit
fun fact
Der erste erfolgreiche Versuch, Kaffee zu entkoffeinieren, gelang Anfang des 20. Jahrhunderts – nachdem eine Schiffsladung Rohkaffee mit Meerwasser überflutet wurde.
Der deutsche Chemiker Ludwig Roselius stellte fest, dass das Salzwasser Koffein entzogen hatte.
Er entwickelte daraufhin das erste Decaf-Verfahren – und nutzte dazu Benzol.
Fun Fact im Fun Fact: Benzol ist heute als krebserregend bekannt. Guten Appetit!
schliessen
Kaffeerösten
Beim Rösten verwandelt sich Rohkaffee in das aromatische Genussmittel, das wir kennen. Ähnlich wie beim Kochen wird dabei Hitze gezielt eingesetzt – in einer rotierenden Trommel, die sich in einem spezialisierten Ofen bewegt.
Wichtig: Beim Rösten entstehen keine künstlichen Aromen – es werden lediglich die geschmacklichen Eigenschaften, die bereits im Rohkaffee stecken, betont oder veredelt. Nur die typischen Röstaromen kommen durch den Röstprozess hinzu.
Man unterscheidet grob vier Röstprofile:
Light Roast – hell, fruchtig, betont die Säure
Medium Roast – ausgewogen, süß, balanciert
Dark Roast – kräftig, schokoladig, wenig Säure
Omni Roast – universell geröstet für Filter & Espresso
Rösten ist also kein Aromenzauber – sondern präzise Handarbeit, bei der das Beste aus der Bohne hervorgeholt wird.

Das Rösten von Kaffee– Präzision, Hitze und die Kunst, Aromen freizulegen
Die Röstung ist einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg von der grünen Bohne zur aromatischen Tasse Kaffee. Dabei handelt es sich nicht bloß um ein einfaches Erhitzen, sondern um einen kontrollierten, handwerklichen Prozess, bei dem Hitze, Zeit, Luftstrom und Bewegung perfekt aufeinander abgestimmt werden müssen.
Wie funktioniert das Rösten?
Ähnlich wie beim Kochen erfolgt die Röstung in einem „Backrohr mit rotierender Trommel“. Die grünen Bohnen werden darin gleichmäßig erhitzt – typischerweise auf Temperaturen zwischen 180 °C und 235 °C.
Dabei durchläuft die Bohne mehrere Phasen:
1) Trocknungsphase (bis ca. 160 °C): Wasser verdampft, die Bohne bereitet sich auf chemische Umwandlungen vor.
2) Maillard-Phase (160–200 °C): Zucker und Aminosäuren reagieren → Aromen wie Karamell, Nüsse, Toast entstehen.
3) First Crack (~200 °C): Die Bohne knackt hörbar – Zellstrukturen dehnen sich aus, das Aroma entwickelt sich.
4) Entwicklungsphase: Je nach Dauer entsteht eine helle, mittlere oder dunkle Röstung.
5) Second Crack (~225 °C): Zellwände brechen erneut auf – typisch für dunkle Röstungen mit öliger Oberfläche.
Röstprofile und Kurven
Moderne Röster nutzen sogenannte Röstkurven, um Temperaturverlauf und Geschwindigkeit zu dokumentieren und zu steuern. Entscheidend ist die sogenannte Rate of Rise (RoR) – also wie schnell die Bohne sich erhitzt. Zu schnell? Dann riskierst du verbrannte Aromen (Scorching). Zu langsam? Dann bleibt der Kaffee flach und unausgereift.
Jede Bohne reagiert anders – je nach:
– Herkunft & Aufbereitung (z. B. Natural, Washed)
– Dichte & Größe
– Feuchtigkeitsgehalt
Ein erfahrener Röster berücksichtigt all das – es gibt kein „Einheitsprofil“.
Luft, Bewegung und Sensorik
Der Luftstrom spielt eine große Rolle: Er transportiert Feuchtigkeit, Rauch und feine Schalenreste (Silverskin) ab – und sorgt für gleichmäßige Hitzeverteilung. Auch die Trommelbewegung verhindert lokale Überhitzung.
Röstung ist kein reiner Technikjob. Profis verlassen sich zusätzlich auf ihre Sinne:
– Geruch: von grasig über brotig bis schokoladig
– Geräusch: First Crack & Second Crack
– Aussehen: Farbe, Glanz, Bohnenstruktur
– Geschmack: Beim Cupping werden Röstprofile verkostet um eventuelle Röstdefekte zu lokalisieren
Rösten veredelt – nicht erfindet
Wichtig:
Beim Rösten werden keine Aromen „hinzugefügt“. Es entstehen lediglich Röstaromen – z. B. Schokolade, Nuss, Karamell – durch chemische Reaktionen. Alle anderen Geschmacksnoten (z. B. Frucht, Florales, Säure) sind bereits in der Bohne angelegt – der Röstprozess bringt sie nur hervor ,unterstreicht sie im besten Fall oder determiniert sie.
Die wichtigsten Röstgrade im Überblick
– Light Roast: Helle Bohne, fruchtig, säurebetont, ideal für Filterkaffee
– Medium Roast: Ausgewogen, süß, nussig, vielseitig einsetzbar
– Dark Roast: Kräftig, rauchig, wenig Säure, ideal für Espresso
– Omni Roast: Kompromissröstung für Filter & Espresso geeignet
Fazit
Kaffeerösten ist eine Kombination aus Technik, Sensorik und Erfahrung. Die besten Röstungen entstehen nicht durch Maschinen allein, sondern durch Menschen, die wissen, wann das volle Potenzial einer Bohne erreicht ist*– und dann den perfekten Moment zum Abkühlen treffen.
fun fact
Ein kreativer Tüftler in Kalifornien hat tatsächlich eine Kaffeeröstmaschine gebaut, die mit Spiegeln und Sonnenlicht funktioniert – ganz ohne Strom.
Das Ergebnis? Super nachhaltiger Kaffee… solange die Sonne scheint.
Schlechte Nachricht: An bewölkten Tagen dauert die Röstung ewig. Gute Nachricht: Perfekt für Slow Coffee – im wahrsten Sinne!
schliessen